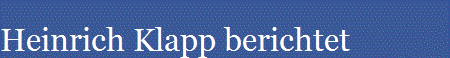|
Die Zeit nach dem II. Weltkrieg
V. Einheimische und Heimatvertrieben in Altenstädt
(Von Heinrich Klapp (Sonderband Arbeitskreis Heimatgeschichte Naumburg 2/1985)
Heinrich Klapp war Bürgermeister in Altenstädt von 1952-1971
Mit dieser Frage wurden in erster Linie der Bürgermeister und der Gemeindevorstand konfrontiert. Es war deren Aufgabe und Pflicht, beiden „Parteien“ in der gegebenen Zwangslage sachlich, gerecht und loyal eine Brücke zum möglichst reibungslosen Miteinader und Zusammenleben zu bauen. Es musste von vornherein alles darauf angelegt werden, eine gegenseitige Verständigung zu erreichen und den Dorffrieden zu bewahren. Die Interessen der Einheimischen waren selbst in dieser aktuellen Situation andere als die der Heimatvertriebenen. Sie auf einen Nenner zu bringe, war keine Kleinigkeit. Dazu gehörte für die Verantwortlichen eine gute Portion Durchsetzungsvermögen.
Dieser großen Mühe und Belastung waren von mir die Bürgermeister August Schlutz (1937-45), Wilhelm Schreckert (1946-48), August Pfennig (1948-51) und wieder Wilhelm Schreckert (1951-52) ausgesetzt und mir ihnen natürlich die Gemeindevorstände. Diesem Gremium habe ich seit dem Frühjahr 1948 angehört, bis ich selbst 1952 das Amt des Bürgermeisters übernahm. So habe auch ich mich mit dem seinerzeitigen Geschehen und seinem lauf tiefblickend und nachhaltig beschäftigen müssen.
Schon vor dem Feldzug gegen Frankreich hat das Dorf einen Vorgeschmack von den Auswirkungen eines Krieges erhalten, als die Saarländer aus ihrer Heimat evakuiert wurden. Diese Einquartierungen, die auf eine geringe Anzahl von Familien beschränkt war, dauerten nicht sehr lange. Sie fanden ihr Ende mit dem kurzfristigen Ausgang dieses Teils des Krieges. Mit grauenvoller Gründlichkeit wurde im Oktober 1943 ein großer Teil der Kasseler Innenstadt zerstört. Das hatte eine Massenflucht und –evakuierung auf das Land zur Folge. Noch von den Schrecken der Bombardierung gezeichnet, kamen viele Kasseler Bürger auch nach Altenstädt, natürlich auch die, die hier im Dorf Verwandte hatten. Sie wurden mit sehr viel Anteilnahme aufgenommen. Bei dem unbeschrittenen großen Mitgefühl gab es keine Schwierigkeiten.
Als dann im Jahre 1945 vom Landrat in Wolfhagen eine für unser Dorf doch sehr große Zahl von Deutschen aus der Tschechoslowakei (Sudentenland, Mähren und Böhmen) nach Altenstädt eingewiesen worde war, wurde es mit dem Wohnraum im Dorf sehr eng. Die Evakuierten und die Heimatvertriebenen machten es erforderlich, dass auch der letzte, unbenutzte Raum für ihre Aufnahme in Anspruch genommen werden musste. Altenstädt war damals viel kleiner als heute. In seinen Häusern und Höfen wohnten meist schon 3, wenn nicht gar 4 Generationen zusammen. Der einzige größere Raum war die Wohnküche, alle anderen Räume waren mehr oder weniger kleinere Schlafräume. Wo sollte man da – zusätzliche – größere heimatvertrieben Flüchtlingsfamilien wohnraumgerecht und menschwürdig unterbringen? Wenn es auch auf die Dauer unhaltbar war, eine mehrköpfige Familie in einem einzigen, dazu noch kleinen Raum leben zu lassen, mussten viele zunächst damit vorlieb nehmen, bis sich eine günstigere Lösung ergab. Dann erfolgte selbstverständlich eine Umquartierung. Hier klafften manchmal die Ansichten der Dorfführung mit denen der Einheimischen, aber auch Heimatvertriebene auseinander. Wo keine Einsicht und kein Kompromiss möglich waren, musste leider behördliche Nachhilfe dafür sorgen, dass man sich den Notwendigkeiten fügte. Wo sollte denn die Gemeinde den Wohnraum für eine auf über 1.000 Einwohner gestiegene Bevölkerung hernehmen, wenn nicht von vorhandenem?!
(Es wurde in dieser für ein Dorf turbulenten Zeit bedauerlicherweise nicht daran gedacht, festzuhalten, wie viele Menschen in einem Haus zusammenleben mussten, Einheimische, Evakuierte und Heimatvertriebene. Dann hätte man ein historisches Zeugnis für die erforderlichen Anordnungen des Bürgermeisters und seines Beistandes und die nicht zu vermeiden gewesene Überbelegung de vorhandenen Wohnraumes. Das Zeugnis wäre ein Freispruch für viele getroffene Entscheidungen).
Die ankommenden Heimatvertriebenen wurden in den ersten Tagen von ihren Quartiergebern verpflegt und versorgt, wobei man es – trotz der Zwangswirtschaft – nicht sehr genau nahm. Schließlich hatten die Einheimischen immer noch ein bisschen mehr an Grundnahrungsmitteln, als es auf Karten nah Menge, Gewicht, Stück usw. gab. Nach Recht und Gesetz hätten die Bauern soviel von ihren Erzeugnissen und ihrer Produktion abgeben, abliefern müssen, dass sie nicht besser gestellt gewesen wären, als diejenigen, die ihre Lebensmittel nur nach der Zuteilung auf Karten erhielten. Wer hiernach verfuhr und bei allem ein reines Gewissen hatte, konnte dennoch – über sein Soll hinaus – Überschüsse erwirtschaften, die er – ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen – für sich verwenden konnte. Theorie und Praxis klafften auf dem Lande – naturgemäß – auseinander. Andererseits kam dies vielleicht auch dem Heimatvertriebenen zugute, wenn sich zwischen den Einheimischen und ihm ein gutes Verhältnis herausgebildet hatte. Die meisten von ihn blieben sich ja nicht auf die Dauer fremd, zumal, wenn beide Seiten eine gegenseitige Rücksichtnahme konstatierten.
Schwieriger wurde es, wenn die Heimatvertriebenen gezwungen waren, sich selbst zu versorgen, zu verpflegen und zu kochen. Wo sollte das geschehen können? Aus den letzten Winkeln holte man den letzten hierfür brauchbaren Gegenstand. Not macht erfinderisch, und hier zeigten die Heimatvertriebenen, was man aus Selbsterhaltungstrieb alles zuwege bringen konnte. Unter irgendeinem Dach hatten es die Heimatvertriebenen vielfach zur Führung eines eigenen „Haushalts“ gebracht. Sie waren ja keineswegs anspruchsvoll und fanden sich mit dem ab, was möglich war oder möglich gemacht werden konnte. Den „Flohmarkt“ gab es also schon. Die Heimatvertriebenen lebten praktisch von der Fürsorge des Landes. Die finanzielle Unterstützung – gemessen an den Hunderttausenden, die durchgehalten werden mussten – war so gering, dass sie gerade noch zum Existenzminimum ausreichte. Die Not war erschütternd, hatten doch viele Vertriebene nur das noch retten können, was sie auf dem Leibe trugen. Zugegeben, dass ihnen die Ortsansässigen wie reiche Leute vorkommen mussten, aber auch sie waren auf Dinge angewiesen, die der Zwangsbewirtschaftung unterlagen und die man nur auf Bezugsscheine erhalten konnte. In dieser Beziehung hatte das Bürgermeisteramt mit beiden Seiten seine Schwierigkeiten, weil jeder Antragsteller, dem sein Begehren nicht sofort Rechnung getragen werden konnten, mit der Ablehnung unzufrieden war. Sie waren vielfach des Glaubens, sie würden benachteiligt und andere bevorzugt. Die Entscheidungen fielen aber wirklich nur nach Dringlichkeit und nichts anderem.
Noch enger, noch schlimmer wurde es 1947/48 mit der Einweisung einer größeren Zahl Volksdeutscher aus Rumänien und Jugoslawien, die bereits 1944 und schon früher ihr Land verlassen mussten, um in die deutschen Ostgebiete umgesiedelt zu werden, jetzt aber zum zweiten Male vertreiben wurden. Sie waren wohl die vom Schicksal am härtesten Betroffenen und die Ärmsten unter den Armen. (Zum Teil hatte man diese Volksdeutschen auch in den besetzten Westgebieten Polens ansässig machen wollen.
Es blieb uns gar nichts anderes übrig, als zu helfen, wo zu helfen war. Es musste auch der letzte Einheimische einsehen, dass es ihm doch sehr viel besser ging, als den vom Unheil verfolgten Heimatvertriebenen. So musste es über kurz oder lang zur gegenseitigen Verständigung kommen. Das geschah da, wo der Vertriebene seine Hilfe anbot, zugriff, wo es notwendig war. Es gab ja unter ihnen viele gewitzte Handwerker, die ihr Fach verstandne und das auch immer wieder unter Beweis stellten. Die Bauern waren froh, wenn es unter den Neubürgern Leute gab, die ihre damals noch nicht technisch so hochentwickelten Maschinen instand setzen und –halten konnten. Ich kann es nicht anders sagen: Die Ausgewiesenen haben immer wieder nach Arbeit gesucht, natürlich auch, um etwas zu zuverdienen und wenn es nur um Lebensmittel ging.
Mit der Währungsreform im Juni 1948 besserten sich die Verhältnisse, zunächst sehr langsam, dann aber zusehends. Die Zahl der Evakuierten nahm immer stärker ab, und auch eine Anzahl Sudetendeutscher wanderte bald ab. Es waren Musikinstrumentenbauer, die sich mit ihren Landsleuten vom gleichen Fach in der Bundesrepublik verständigt hatten und im Harz einen eigenen Betrieb begründen wollten. Dann waren es Fachleute aus der Lederbranche, die in Regensburg eine eigene Gerberei einzurichten beabsichtigten. Auch andere hatten schon das Glück, irgendwo Arbeit und Brot zu finden und Altenstädt verlassen zu können.
Es muss in diesem Zusammenhang aber auch noch die „Soforthilfe“ (Gesetz zur Milderung dringender sozialer Notstände vom 08.08.1949) im Rahmen des Lastenausgleichs erwähnt werden. Diese Maßnahme kam reichlich spät: 4 Jahre nach dem Kriegsende. Sie war aber tatsächlich erst nach der Währungsreform möglich. Die Leistungen nach dem Soforthilfegesetz umfassten Unterhaltshilfe, Hausratshilfe, Ausbildungshilfe, Aufbauhilfe und Gemeinschaftshilfe. Ein Rechtsanspruch bestand nur bei der Unterhaltshilfe. Diese erhielten bei Bedürftigkeit Männer über 65 und Frauen über 60 Jahre sowie alle in der Erwerbsfähigkeit um mehr als 50% beschränkten Personen (70,- Dm Monatlich, dazu für die Ehefrau 30,-DM und für jedes Kind 20,-DM; dazu seit 1.1.1951 Teuerungszuschläge von 15,-DM und je 7,50DM für Ehefrau und Kinder). Durch diesen finanziellen Hilfsfond konnte ziemlich viel Bedürftigkeit und Ärmlichkeit abgeschwächt werden.
Hatten die Einheimischen jahrelang die Bürde der Einquartierung auf sich genommen, so mussten sie ihren nicht geringen Beitrag zum Lastenausgleich leisten, der ja eine wirtschaftlich tragbare Schadensteilung zwischen den Kriegs- und Kriegsfolgeschäden in Vermögen oder wirtschaftlicher Stellung hart getroffenen und denen, die ihre Besitzstand ganz oder teilweise bewahrt haben, zum Ziele hatte. Hierdurch hat mancher Einheimischer arg Federn lassen müssen, die auch nicht von heute auf morgen nachgewachsen sind.
Zum Abschluss möchte ich sagen, dass die Zeit der großen Not nach dem Ende des Krieges von allen Beteiligten hier am Ort mit viel gutem Willen durchgestanden wurde, wenn es auch nicht immer nach Wunsch des Einzelnen ging.
Zu große, ins Gewicht fallende Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Heimatvertriebenen ist es hier nicht gekommen. Aus meiner Sich haben sich das Dorf und seine Einwohner verantwortungsbewusst und untadelig verhalten, wie es nicht anders sei kann, wenn Menschen in Not sind. Aber auch den Evakuierten und den Heimatvertriebenen sei für ihr Verhalten Anerkennung gezollt.
Der beste Beweis dafür ist, dass zahlreiche Ausgewiesene hier geblieben sind, Altenstädt zu ihrer Wahlheimat gemacht und sich mit Einheimischen verschwägert haben. Längst sind sie zu „Alteingesessenen“ geworden.
|