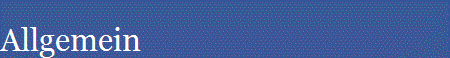|
Die Zeit nach dem II. Weltkrieg
I. Die Nachkriegszeit und Heimatvertriebene in Altenstädt
(Text von Willi Gerhold - veröffentlicht in der Festschrift zur 1175-Jahrfeier 2006)
Der Einzug der Amerikaner zu Ostern 1945 bedeutete auch für die Altenstädter eine große Umstellung. Viele mussten ihre Wohnung räumen damit die Soldaten einziehen konnten. Oft führte das zu erheblicher Beschädigung der Räume. Für viele Dorfbewohner ungewohnt auch besondere Angewohnheiten der Soldaten, etwa wenn diese Ihre Füße auf den Tisch legten. In den Gastwirtschaften Ritter und Schlutz waren besonders viele untergebracht. So wurde z.B. in der Gastwirtschaft Schlutz gekocht, so dass jeder hier sein Essen abholen musste.
Auf einer Wiese (Schlutz), wo heute das DGH steht, hatte die Soldaten ihren Sportplatz eingerichtet. Eigens dafür wurden aus dem Hattenhäuser Wald Bäume herangeschafft und eine Tribüne gebaut.
Ein weiteres großes Problem waren nach der Zerstörung Kassels Die Evakuierten und die vielen Flüchtlinge aus den Gebieten östlich der Oder/ Neiße, aus der CSSR, vom Balkan und schon zuvor ab 1943 aus dem Saarland. Die Bevölkerung wuchs um mehr als 30% und alle mussten mit dem nötigsten versorgt werden.
Lebensmittel waren knapp es gab alles nur auf Bezugskarte. Das was von den Bauern „zuviel“ produziert wurde, Milch, Fleisch oder Getreide musste abgeliefert werden. Zum Beispiel Eier bei Kolonialwarenladen Schnellenpfeil.
Auch für die Schule galt es „Herkulesaufgaben“ zu bewältigen. 170 Kinder wurden von nur einem Lehrer „versorgt“. Zu Weihnachten 1946 veranstaltete die Schule eine Weihnachtsaufführung deren Erlös den Neubürgern und den Familien die noch Angehörige in Gefangenschaft hatten zu kam. Als Weihnachtsgabe gab es für jede Person ein Pfund Weizenmehl und für die Kinder Gebäck. Viele der Lehrer an der Schule waren ebenfalls Heimatvertriebene.
Hier einige Namen an die sich sicher noch viele erinnern werden:
Aus Schlesien Gerhard Kockegey
Aus Ostpreußen Adolf Piek
Aus der CSSR Alois Lackinger
Aus der CSSR Helene Enge
Viele konnten schon damals Grundkenntnisse in Englisch erlernen, das „Mouth“ von Lehrer Piek wurde gründlich vermittelt.
Noch größere Probleme als im Schulwesen gab es für die politisch Verantwortlichen, die Bürgermeister und den Gemeindevorstand, zu bewältigen.
Hier die Einheimischen und dort die Vertriebenen, für beide „Parteien“ musste ein reibungsloses Zusammenleben ermöglicht werden, waren doch ihre Interessen teilweise sehr unterschiedlich. Oft mussten die verantwortlichen Politiker eine gute Portion Durchsetzungsvermögen an den Tag legen. Altenstädt war ja nicht so groß wie heute, und nicht selten lebten drei auch vier Generationen unter einem Dach. Und nun musste auf dem wenigen Platz noch Wohnraum für die Vertriebenen freigemacht werden. Hier klafften manchmal die Ansichten der Amtsführung mit denen der Einheimischen oder auch der Vertriebenen auseinander, was oft nur durch behördliche Anweisungen geregelt werden konnte..
Leider gibt es keine Aufzeichnungen darüber wie viele Menschen in einem Haus (pro/qm) zusammen leben mussten. Im ehemaligen Haus Bräutigam in der Teichstrasse (heute Böhler) lebten aber beispielsweise 10 Personen.
Aber es gab auch andere Lösungen: Meistens wurden die ankommenden in der ersten Zeit von ihren Quartiergebenden verpflegt und mit dem nötigsten versorgt. Obwohl die Lebensmittel alle mit Karten zugeteilt wurden, hatten die Einheimischen immer noch eine Reserve an Grundnahrungsmitteln zur Verfügung.
Der Wohnraum für die Neuankömmlinge beschränkte sich oft auf ein Zimmer, wo sollte da ein Herd oder andere Möbel Platz finden Spannungen waren da vorprogrammiert. Oft war es auch so dass sich die Menschen in der Landwirtschaft einbrachten und so zum Lebensunterhalt beitragen konnten.
Andere wiederum hatten sich schon bald aus den „letzten Winkeln“ brauchbare Gegenstände besorgt und konnten bald so ihren eigenen „Haushalt“ führen.
Die finanzielle Unterstützung durch den Staat war sehr gering, so dass diese gerade zum Existenzminimum ausreichte.
Mit der Währungsreform 1948 besserten sich die Verhältnisse, zunächst eher langsam, dann aber zusehends. Die Evakuierten zog es zurück in ihre Heimatstädte.
Viele der Vertriebenen suchten sich in anderen Orten der Bundesrepublik eine Arbeit und Unterkunft.
Darüber hinaus steht wohl unbestritten fest, dass sich die Heimatvertriebenen, soweit sie in Altenstädt ansässig wurden, in über 50 Jahren sehr gut eingebürgert haben. Sie haben einen großen Anteil an der Entwicklung im Dorf. Viele haben Einheimische geheiratet und so zu einem guten Miteinander beigetragen.
Hier noch einige Familiennamen von vertriebenen Familien, die sicher noch vielen geläufig sind:
.Kockegey - Lokay – Wilfling – Ginda – Perschke – Lugert – Dormann – Schmidt – Seeger – Dary – Höpfl – Skiwa – David – Seitz - Olschansky
Leistner – Piek – Baumgart – Härtel – Bareuther – Tusche – Franz – Rieger – Mucha
Riedl – Reimus – Bartholmai – Wiltschko – Schuchhardt - Wallny
Auszug aus der Schulchronik von 1947:
“Der Minderertrag der Kartoffelernte gefährdete die Einkellerung an Kartoffeln im Lande. Da das Liefersoll der Gemeinde voll erfüllt wurde, konnte an die Nichtselbstversorger 2 Ztr. Winterkartoffeln(Kartoffeln waren die wichtigste Nahrungsquelle) je Person ausgegeben werden. Auf Initiative von Ortslandwirt Derx war eine Mehlsammlung in der Gemeinde so groß ausgefallen, dass pro Neubürger ein Pfund Weizenmehl ausgegeben werden konnte. Eine gemeinsame Weihnachtsfeier von Roten Kreuz und Arbeiterwohlfahrt am ersten Feiertag im gefüllten Saal der Gastwirtschaft Ritter brachte einen Reinertrag von 500,- RM, der komplett in einen Unterstützungsfond für Neubürger floss.”
|